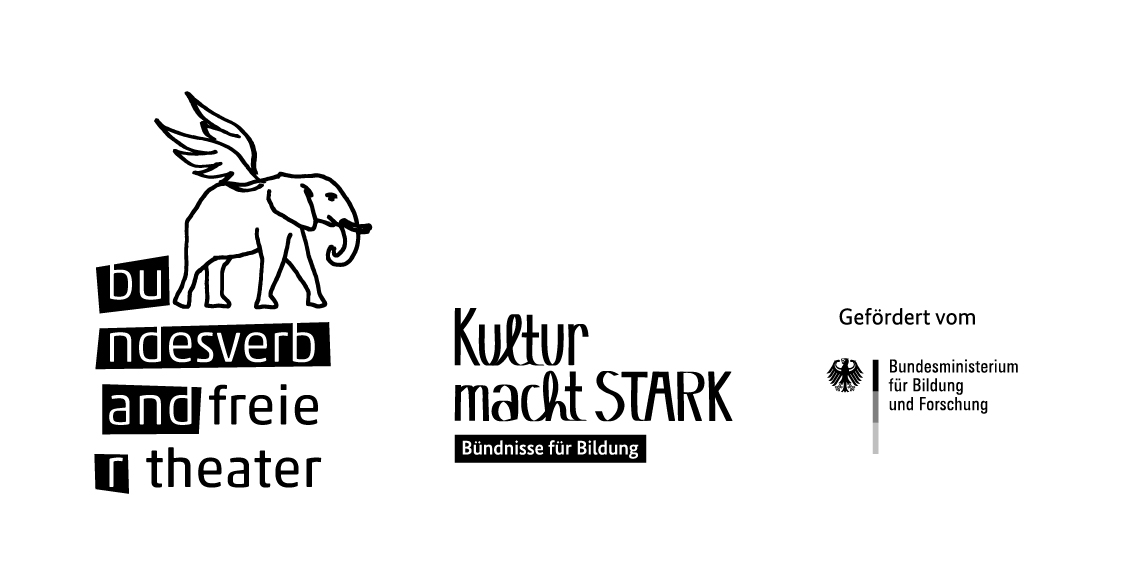Neulich fand ich beim Spaziergang mit dem Sohn 10 Pesos. Wir bewunderten die goldene Münze, steckten sie zum Spielen ein, und ich war nur ganz kurz enttäuscht, dass es kein „echtes“ Geld war. Und dabei wurde mir das mal wieder klar: Wie viel ich in letzter Zeit über Geld rede. Über Geld, das habe ich 2017 gelernt, redet man nämlich vor allem dann, wenn man keines hat.
Freiheit in der Freiberuflichkeit
Ich liebe die Freiheiten, die mir die Freiberuflichkeit manchmal bietet: Vor allem die Chance, mir selbst Projekte auszudenken. Wie oft höre ich andere Menschen bitterlich klagen: über idiotisch konstruierte Programme, Ressourcen-fressende Organisationsstrukturen und inhaltlich verfehlte Entscheidungen von „oben“. Großartige Kolleg_innen verschleißen sich in Dienstreiseanträgen und Routine-Aufgaben. Man würde gern soviel anders machen, und es geht nicht. Nicht. Nicht. Nicht.
All dem versuche ich mich durch die Freiberuflichkeit zu entziehen, und das war mir lange eine Menge Geld wert. Wie ich schon in meinem ersten Artikel hier auf diesem Blog schrieb: Ich bin immerhin ein bisschen frei.
Natürlich musst auch ich mich an die Logik von Fördermittelvergabe und Vernetzungsstrategien anpassen. Natürlich siebe auch ich inzwischen meine Ideen ganz automatisch und überlege, ob sie förderfähig sind, bevor ich viel Zeit investiere. Natürlich muss auch ich immer wieder Mitstreiter_innen finden. Und Kooperationen mit Institutionen sind auch nicht immer leicht, wenn man allein auf der anderen Seite steht. Aber meinen Tagesablauf bestimme ich selbst, und dazu gehört eben auch, die freie Wahl zu haben, ob ich für ein bestimmtes Projekt MEHR mache. Mit dem Geld kam ich in der Vergangenheit irgendwie hin, es reichte und ich hatte Spaß. Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung sind siamesische Zwillinge, das wissen alle in der Branche.
Zurück aus der Elternzeit
Diese Freiheit hat sich verändert. Man weiß es ja irgendwie, aber es ist doch heftig: Aus der Elternzeit zurückkommen und sich umstellen. Plötzlich schlagen die Risiko-Faktoren der Freiberuflichkeit härter zu:
1. Faire Bezahlung: Ich achte darauf, dass meine Projektstunden einigermaßen fair bezahlt werden – unter bestimmte Grenzen gehe ich nicht und wünsche mir das auch von meinen Kolleg_innen. Was aber ist mit den vielen Arbeitsstunden, die einfach nie vergütet werden: Für Antragstellung (und hundertfache Überarbeitung, die Feedbackrunden nehmen da ja manchmal kein Ende), Vor- und Nachbereitung, Verwaltung etc.? Aus meiner Sicht das größte Problem.
2. Krankheit: Krank werden sollte man nicht – ich bin auch schon mit verstauchtem Fuß über vereiste Straßen zur Probe gehinkt. Stundenausfall wird nicht bezahlt. Aber ich war ja gesund! Nun allerdings wollen auch noch die Infekte des Sohns versorgt werden. Bleibe ich zwei Tage zu Hause, bekomme ich von der Krankenkasse 20€. Und war gegebenenfalls aus Auftraggeber_innensicht unzuverlässig. Yay.
3. Zeit für Vernetzung: Die Zeit ist knapp, viele Gelegenheiten, potentielle Kooperationspartner_innen zu treffen verstreichen. Im Zweifel, weil ich eine Deadline schaffen muss. Oder weil ich jetzt eben einfach ein Familie habe.
Während die Kolleg_innen um mich herum allerdings immer betriebsamer auf mich wirken, muss ich mir selbst eingestehen, dass ich doch die Schlimmste von allem geworden bin: 2017 habe ich gearbeitet wie verrückt.
Gearbeitet wie verrückt
Ich habe Wochenendarbeit mit Kind auf dem Rücken, Abendarbeit mit Kind neben mir im Bett, Teamrunde mit Kind und Spielzeug in der Mitte und telefonisches Bewerbungsgespräch mit Kind das Gegenstände durchs Badezimmer wirft erlebt (doch, den Auftrag habe ich bekommen). Mit juckenden geschwollenen Händen (Hand, Mund, Fuß, ja, zu Hause kommen die tollsten Keime an) habe ich eine Bewerbung getippt und bin 10 Tage später mit sich schuppenden, verheilenden Händen zum Bewerbungsgespräch gefahren. In der schlimmen Norovirus-Nacht habe ich meinen Sohn gehalten, am nächsten Morgen habe ich geduscht, meine Hände mit Sterilium Virugard behandelt und bin in die Nachbarstadt gefahren – wichtige Termine. Und in manchen Monaten habe ich mit all dem 300 € verdient.
So war es doch immer schon…
Andere Eltern werden abwinken: „so war es bei uns doch immer schon!“ – oder entsetzt sein: „such dir doch eine Stelle“ – ich persönlich bin wütend. Dass mein Engagement so wenig wert sein soll. Die meisten meiner Aufträge werden schließlich streng geprüft, und anders als bei so liederlichen Vorhaben wie einem Flughafen oder einem S-Bahntunnel darf ich mich niemals verkalkulieren – auch nicht um nur 50 €. Falls ich jemals den Kleinunternehmerinnen-Status verliere (also mehr als 17500 € jährlich verdiene), werde ich auch saftig Umsatzsteuer abführen müssen, die ich mangels Ausgaben nicht wieder reinholen können werde. Es lohnt sich also noch nicht einmal für mich, irgendeinen Wunderauftrag zu generieren, der mich finanziell so richtig schön ausstattet. Und schließlich arbeite ich hauptsächlich mit gesellschaftlich relevanten Gruppen (Kinder, Jugendliche, Geflüchtete etc.), deren Wichtigkeit immer wieder betont wird. Und die man gern mit billigen Honorarkräften preiswert versorgt. Oder genauer: Die unser Staat mit seiner demokratisch gewählten Regierung und seinem Steueraufkommen gern preiswert mit sich selbst ausbeutenden Honorarkräften versorgt. Die der Institution das unternehmerische Risiko abnehmen und von dem Lohn noch nicht einmal ein (!) Kind ernähren können.
Und das betrifft nicht nur Künstler_innen: Der freie Bildungssektor, die Reinigungsfachkräfte, Übersetzer_innen und und und. Einzelunternehmer_innen sind billig. Vor allem, weil man nicht jede Stunde bezahlen muss.
Ich wiederhole mich: Ich war immer gerne frei. Freiheit heißt inzwischen auch, dass ich meinen Teil zum Familieneinkommen beitragen kann. 2018 hat gerade erst begonnen, und ich bin auf der Suche: Nach einer neuen Strategie. Vorschläge sind sehr willkommen.